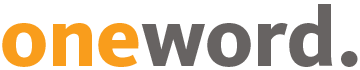29.04.2025
Quality Time mit Dr. Christopher Kurz: Die ISO 5060 als Werkzeugkiste für objektive Übersetzungsevaluierung
Es ist wieder Quality Time. In einer neuen Episode unserer Reihe von Expertengesprächen hat sich Eva-Maria Tillmann, Leitung Qualitätsmanagement bei oneword, mit Dr. Christopher Kurz, Head of Translation Management bei ENERCON, unterhalten. Im Gespräch erzählt Dr. Kurz von seinem bemerkenswerten Weg bis hin zum Projektleiter der ISO 5060 für die Evaluierung von Übersetzungen. Ein interessanter Austausch über Normen in der täglichen Praxis, den konkreten Nutzen für Auftraggeber:innen auch in Zeiten wachsender KI-Anwendungen.
oneword und ENERCON verbindet seit 2018 eine starke Partnerschaft. oneword ist nicht nur einer der Übersetzungsdienstleister von ENERCON, Eva-Maria Tillmann und Dr. Christopher Kurz arbeiten beide aktiv im Gremium für Übersetzungsdienstleistungen an den Normen der Branche mit. Dr. Christopher Kurz ist Diplomübersetzer (Englisch und Italienisch mit dem Schwerpunkt Maschinenbau und Bauwesen) mit jahrelanger Erfahrung nicht nur im Übersetzen, sondern auch im Projekt- und Übersetzungsmanagement bei Übersetzungsdienstleistern und Großkonzernen. Mittlerweile leitet er das Übersetzungsmanagement bei ENERCON, einem globalen Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen. Er ist seit 2011 aktiv bei DIN und ISO und ist Projektleiter der Norm ISO 5060 – Evaluation of Translation Output, eine Norm für die Evaluierung von Übersetzungen.
Eva-Maria Tillmann (EMT): Hallo Christopher! Schön, dass wir uns heute hier austauschen können. Wir kennen und schätzen uns ja schon seit vielen Jahren. Unser erstes Treffen war auf der tekom-Jahrestagung 2016. Ich hatte zur Vorbereitung meines Vortrags über Übersetzungsqualität und ISO 17100 deine Doktorarbeit mit dem Titel „Translatorisches Qualitätsmanagement“ gelesen und darüber kamen wir ins Gespräch. Ich glaube, damals hattest du das erste Mal vorgeschlagen, dass ich bei DIN mitarbeiten könne.
Dr. Christopher Kurz (CHK): Richtig genau.
EMT: Zur Mitarbeit bei DIN kam es für mich dann erst 2018, da hast du mich als Gast zur Sitzung des Ausschusses für Übersetzungsdienstleistungen eingeladen. Dort bin ich seitdem total begeistert tätig und zusammen mit den anderen Expert:innen aus der Branche haben wir mittlerweile auch einige Normenprojekte bearbeitet, auf die wir wirklich stolz sein können. Eines davon war ISO 5060 zur Evaluierung von Übersetzungen, bei dem du die Projektleitung übernommen hast.
Erzähl doch mal, wie kamst du denn selbst zur Normungsarbeit? War das, weil du dich schon in der Promotion mit dem Thema beschäftigt hast, oder warst du da umgekehrt schon längst bei DIN und ISO aktiv?
CHK: Ja, lange Geschichte. Eva, ich freue mich erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde, das ist eine wunderschöne Gelegenheit, dass wir gemeinsam auf das Thema Normung und auf die ISO 5060 zurückblicken. Für deine Frage hole ich etwas aus zu meinem persönlichen Background: Ich habe in meinem Studium in Leipzig einen recht guten Rundumblick über das Thema Übersetzen bekommen, inklusive defekte Ausgangstexte, Terminologie, Tools, Prozesse, Qualitätsmanagement etc. – also alles, was die Übersetzungsqualität beeinflusst. Ich habe darüber hinaus auch während meines Studiums ab dem Frühjahr 2000 als Freiberufler für Endkunden übersetzt. Nach Abschluss meines Studiums habe ich dann über den Umweg bei einer Leipziger 6-Mann-Agentur 2006 bei SDL in München angefangen und Großkunden und wichtige Kundenprojekte betreut und mich auch damals schon für eine Promotion interessiert. Das war im Jahr 2007, und es war schnell klar, dass ich das Thema Qualität spannend finde und damit auch die Themen Übersetzungsfehler, Auswirkungen, Bewertung und Qualitätssicherung. Wir als Lead-Translators bei SDL, heute RWS, wurden regelmäßig von den Kollegen bewertet und haben auch selbst die Kollegen bewertet. In dieser Zeit habe ich sehr viel darüber gelernt, was Übersetzungsqualität ist und wie sie entsteht.
EMT: Das glaube ich.
CHK: Das Thema hat mich dann weiter interessiert, aber ich konnte es bei meinem damaligen Arbeitgeber nicht weiterverfolgen. 2010 bin ich dann auf die Herstellerseite zu BMW gewechselt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits meine Promotion zum Thema „Translatorisches Qualitätsmanagement” ab 2009 bei Professor Klaus-Dieter Baumann am IALT in Leipzig angefangen und wollte im Rahmen meiner Dissertation die DIN EN 15038, die Vorgängernorm von der ISO 17100, untersuchen. Damals war ich zuerst gegen die Norm, weil ich dachte: „Was für ein Blödsinn, man kann das doch alles gar nicht vorschreiben und ich habe doch gerade in der Praxis erfahren, wie das ganz anders funktioniert“. Ich dachte, vielleicht kann ich die Norm widerlegen – das war eigentlich meine allererste Intention zur Promotion. Ich habe dann angefangen zu schreiben und habe auch, basierend auf meinen Praxiserfahrungen, selbst einen qualitätsorientierten Übersetzungsprozess entwickelt und den kontrastiv gegen die Norm gestellt. Ich hatte mich im Rahmen der Recherche auch an das DIN gewandt und dann hieß es: „Ja, die DIN EN 15038 wird gerade überarbeitet, wir wollen gerade einen ganz neuen Ausschuss deswegen gründen. Wollen Sie da nicht mitarbeiten?“ Und das war im Endeffekt für mich der Startschuss im November 2010, den Weg der Normungsarbeit einzuschlagen, und dann war ich im Frühjahr 2011 bei der ersten Sitzung des aktuellen Normungsausschusses für Übersetzungsdienstleistungen dabei und habe festgestellt, dass Normen sehr viel Gutes bereithalten, sehr viel gute Handreichung geben und dass es eine sehr sinnvolle Arbeit ist, die wir machen. Ich bin dann dabeigeblieben und aktuell eines der letzten zwei Mitglieder von knapp zehn Ausschussmitgliedern, die bei der ersten Sitzung für Dolmetscher und Übersetzer 2011 am DIN dabei waren.
EMT: Dann warst du ja wirklich von Anfang an dabei! Ich habe bei oneword zwar schon seit 2012 die Verantwortung für unsere Zertifizierungen und mich daher auch intensiv mit den Normen unserer Branche beschäftigt, aber nur als Anwenderin, nicht mit der Normungsarbeit als solche. Deshalb hat es mich so interessiert, die Normen selbst auch mitzugestalten, als ich dazu eingeladen wurde. Das war bei dir dann sicher ähnlich. Wir beide wären von selbst nicht auf die Idee gekommen, an der Normung aktiv mitzuarbeiten, fanden es dann aber sofort eine spannende Sache!
CHK: Richtig.
EMT: Jetzt würde mich interessieren, wie du mit dem Thema Evaluierung von Übersetzungen in Berührung gekommen bist. Du hast dann sogar die Projektleitung einer Norm zu dem Thema übernommen, ISO 5060, das heißt ja, man hat auch einen besonderen Bezug zu dem Thema.
CHK: Dieser Bezug kommt einerseits aus meiner Promotion, andererseits durch meine Berufserfahrung als Übersetzer. Mir ist über die Jahre klar geworden, was eine „gute” Übersetzung ausmacht: Im Kern geht es um die Qualitätsauffassung aus der ISO 9001. Es gibt unheimlich viele Vorstellungen und Theorien zu Übersetzungsqualität, aber wenn man in der Praxis ist, merkt man eigentlich: Qualität bedeutet ganz, ganz viel – und das wenigste davon steht in Büchern. Dazu gehören Themen wie die Einhaltung von Terminologievorgaben, die Verwendung von High-Fuzzy-Matches, ohne sie neu zu schreiben, die Kontrolle von Tool-Einstellungen wie z. B. Match-Wert-Grenzen, Optionen wie Auto-Propagated-Fuzzys oder der Fuzzy-Match-Wert in der Terminologieerkennung, die TMs, die Ausgangstexte. Darüber hinaus schauen wir bei ENERCON als Auftraggeber uns auch an, wer für uns arbeitet und wie viel wir an welchen externen Partner vergeben – weil wir nach Metriken arbeiten. Und wir schauen uns natürlich auch den Gesamtprozess inkl. Qualitätsmanagement mit regelmäßiger Auswertung an. Qualität ist ein unfassbar umfangreiches Konglomerat aus so vielen Bestandteilen, das ist unglaublich vielschichtig und setzt sich aus so vielen Faktoren zusammen, dass mich das wirklich interessiert. Wenn man das alles steuert und alle Bälle quasi in der Luft hält – dann kann man von Übersetzungsmanagement bzw. Qualitätsmanagement sprechen.
EMT: Das heißt, dein erster Berührungspunkt mit Evaluierung war bei deiner Arbeit für einen Übersetzungsdienstleister?
CHK: Genau. Ich selbst bin damals bei SDL/RWS als Übersetzer nach dem LISA-Prinzip bewertet worden. Ich habe dann ab 2011 ein ähnliches Qualitätsbewertungssystem für mein Projekt in der betreffenden Abteilung bei BMW eingeführt, und wir haben dann so die eingekauften Übersetzungen bzw. die Dienstleister bewertet. Denn im Endeffekt ist es ja so: als Hersteller bezahlt man für etwas und möchte nachher auch ein Produkt zurückbekommen, das dem entspricht, was man in Auftrag gegeben hat. Dieses dann objektiv zu bewerten, ist ein Teil des Resourcing-Prozesses, weil nur eine Bewertung dem Übersetzer oder dem Übersetzungsdienstleister ermöglicht, effektiv an den eigenen Stellschrauben zu drehen.
EMT: Verstehe. Bei ENERCON hast du das dann auch eingeführt, wie ich ja weiß, denn wir bekommen schließlich auch regelmäßig eure Evaluierungsergebnisse als Feedback.
CHK: Ja genau! Wenn man seine betriebswirtschaftlichen Entscheidungen im Übersetzungsprozess auf Kennzahlen basiert, dann sollten diese Kennzahlen auch wirklich stichhaltig sein, und das geht nur über Objektivität. Und das war von Anfang an der Grundgedanke bei der ISO 5060. Wir wollten sowohl bei ENERCON als auch in der ISO-Arbeitsgruppe Übersetzungsqualität objektivieren und konnten das ISO-5060-Prinzip in der tagtäglichen Arbeit erfolgreich bei ENERCON umsetzen.
Mein Team hat gemeinsam an diesem Übersetzungsqualitätsmanagementprozess gearbeitet und wir haben festgestellt, dass, je klarer wir unsere Anforderungen definieren (das ist ja auch ein wesentlicher Teil der neuen ISO 11669) und je klarer wir sagen, was wir haben wollen und je enger wir sozusagen die prozessualen Leitplanken setzen, umso fehlerfreier läuft eine Übersetzung. Und dann wird diese Arbeit wiederholbar, sie wird planbar und sie verliert ihre Unkontrollierbarkeit. Und das ist das Schöne an der ISO 5060: Sie erfordert professionelle Distanz, also dass der eigene Gusto bei der Bewertung zurückgestellt und dass eine Übersetzung so objektiv und neutral bewertet wird, wie es geht. Wenn man den Handlungsrahmen eng vorgibt, dann kann man auch alles sauber abprüfen und dann ist alles, was eingehalten wird, konform, und alles, was nicht eingehalten wird, nicht konform und damit ein Fehler.
EMT: Hattet ihr das Evaluierungssystem bei euch bereits eingeführt, bevor ISO 5060 in Arbeit war oder war das parallel mit der Erarbeitung der Norm?
CHK: Da lief viel parallel. Die vier Jahre Arbeit an der Norm und die Überarbeitung unserer TQE-Matrix (Anm. oneword: Translation Quality Evaluation) haben sich auch gegenseitig befruchtet und fielen in denselben Zeitraum. Da ist viel aus der Theorie in die Praxis und auch viel aus der Praxis in die Theorie gegangen – allerdings nicht nur von uns, sondern auch durch die Arbeitsgruppe der ISO 5060 mit Teilnehmern aus den unterschiedlichsten Bereichen und aus über 30 Ländern! Die Arbeitsgruppe war großartig, weil echte Experten von Auftraggebern, Dienstleistern, Freiberuflern, Verbänden und Hochschulen ihren Anteil daran hatten. Diese verschiedenen Stakeholder haben ein sehr diverses Bild abgegeben und auch sehr viel verschiedenen Input geliefert, sodass wir auf der einen Seite einige Kompromisse finden mussten, auf der anderen Seite wurde aber auch interessanterweise deutlich, dass die generelle Richtung, in die wir gearbeitet haben, die gleiche war.
EMT: Du sagst es, ISO-Normen sind immer ein Endergebnis vieler Diskussionen und internationalem Konsens. Du musstest als Projektleiter einige Kompromisse eingehen. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ist die Norm deiner Meinung nach praxistauglich?
CHK: Definitiv. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich bin vor allen Dingen sehr zufrieden, dass wir auch alle Stakeholder an Bord behalten haben. Es ist kein Stakeholder abgesprungen, obwohl wir doch aus sehr unterschiedlichen Richtungen kamen und das war schon wirklich prima.
EMT: Entspricht euer Evaluierungssystem bei ENERCON denn jetzt tatsächlich der Norm oder seid ihr davon abgewichen?
CHK: Wir haben Kleinigkeiten angepasst wie etwa die Definition der Schweregrade, aber im Grunde entspricht unser Evaluierungsschema der ISO 5060. Wir haben uns vor der Arbeit an der Norm übrigens auch mit der MQM-Gruppe (Anm. oneword: Multidimensional Quality Metrics) zusammengesetzt und haben einen sehr intensiven, sehr konstruktiven Austausch gehabt, so dass sich MQM und die ISO 5060 nicht widersprechen. Jemand, der also schon nach MQM evaluiert, kann direkt die ISO 5060 einführen.
EMT: Ich finde übrigens auch, dass die Norm sehr breit anwendbar ist. Letztendlich sind wir Übersetzungsdienstleister auch Auftraggeber und kaufen Leistungen ein, d. h. auch wir können ISO 5060 nutzen, um die einzelnen Prozessschritte, die wir untervergeben, zu bewerten. Und ich finde auch, die Norm ist dafür ein super Handwerkszeug. Du hast vorhin schon angerissen, was es euch gebracht hat, Übersetzungsleistungen zu evaluieren. Möchtest du da vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, inwieweit das jetzt für eure Beauftragung von Übersetzungen beziehungsweise für das, was ihr zurückbekommt von euren Dienstleistern, tatsächlich einen Mehrwert hat?
CHK: Ja, gern. Jede Evaluation enthält Datenpunkte, z. B. welche Fehler wie häufig auftauchen und mit welchem Schweregrad. Diese Datenpunkte lassen sich in Grafiken umsetzen – man visualisiert sozusagen die Fehlerbilder. Man kann damit genau sehen, welcher externe Partner in welchem Fehlerbereich seine Probleme hat und wie sich Kennzahlen und Fehlerschwerpunkte über die Jahre entwickeln. Anschließend kann man eben bei diesen Fehlerschwerpunkten punktuell und gezielt nachsteuern.
EMT: Hast du ein Beispiel?
CHK: Bei dem einen externen Partner ist es vielleicht bei Spanisch der Stil, bei Französisch ist es vielleicht Grammatik und vielleicht bei Englisch Mistranslations, also Inhaltsfehler oder Auslassungen. Beim nächsten externen Partner sind Mistranslations bei Englisch überhaupt kein Problem, aber dafür wiederum die Terminologie.
Und so kann man die externen Partner exakt steuern, weil man ihnen anhand der Evaluierungsergebnisse exakt sagen kann, wo ihre Schwachpunkte liegen. Das ist zwar in dem Moment nachgelagert, aber durch einen Kaizen-Prozess kann auch der Dienstleister Maßnahmen anstoßen, damit diese Fehler in Zukunft weniger werden oder nicht mehr auftauchen. Man kann so an der Fehlerursache arbeiten. Und dann hat man wirklich einen Qualitätsmanagementprozess und kommt sozusagen vor die Welle. Man läuft dann nicht mehr hinterher, sondern steuert und lenkt – Management eben.
EMT: Das heißt, ihr konntet dadurch, dass dann allgemein die Qualität wieder besser wurde, bei euch die Risiken senken?
CHK: Ja, es ist auf der einen Seite ein wirksames Mittel zur Risikominimierung und auf der anderen Seite zu höherer Kundenzufriedenheit. Und das Schöne ist natürlich auch, dass die ISO 5060 universell einsetzbar ist. Die ISO 5060 ist offen für jedes Setting: man kann Humanübersetzung, mit oder ohne TM, evaluieren; man kann aber auch MT-Ergebnisse, egal ob uneditiert oder posteditiert, evaluieren, weil das Zentrum von der ISO 5060 der Abgleich mit Anforderungen ist. Da spiegelt sich auch ganz klar der ISO-9001-Gedanke wider. Und das ist ein hervorragender Weg, sicherzustellen, dass man auch genau das bekommt, was man bestellt hat.
EMT: Für uns Dienstleister ist auch immer wichtig, die Prozesse zu verbessern und so auszurichten, dass alle Kundenanforderungen eingehalten werden. Wenn dann Auftraggeber:innen die Spezifikationen so genau und konkret ausgearbeitet haben wie ihr, dann ist das für uns auch ein echter Gewinn.
Dieser Austausch ist sehr vorbildlich und das ist längst nicht bei allen Auftraggeber:innen so. Es ist natürlich keine Pflicht, aber wie du sagst, man möchte das Risiko für das eigene Unternehmen minimieren und die Endkund:innen zufriedenstellen und wenn dann im Prozess etwas nicht stimmt, dann muss es angegangen werden.
CHK: Ja, genau. Unsere Anforderungen an den Übersetzungsprozess haben wir auch mithilfe der ISO 17100 erarbeitet. Wir sind zwar nicht nach der ISO 17100 zertifiziert, aber wir arbeiten nahezu konform nach dieser Norm, und sie hat uns auch hervorragend dabei geholfen, die Leistungsbeschreibung aus dem Rahmenvertrag zu entwickeln.
Als Übersetzungsmanagement konnten wir viel von den Prozessen anderer Abteilungen lernen, Teilprozesse abschauen und somit den Übersetzungsprozess wirklich industrialisieren: weg von der rein ausführenden Sprachenabteilung oder vom „Sprachenonkel“ hin zu einem voll integrierten und gestaltenden Teilprozess in der Wertschöpfungskette. Dabei haben die Evaluierung und die von ihr abgeleiteten Übersetzungskennzahlen auch eine große Rolle gespielt.
EMT: Kommen wir mal zum Thema künstliche Intelligenz: Denkst du, eine KI kann die Fehlerkategorien aus ISO 5060 abprüfen und korrigieren?
CHK: Florian Faes von Slator hat so schön gesagt, dass die ISO 5060 eine Toolbox ist. Wir geben den Anwendern einen Werkzeugkasten an die Hand, und sie können alle Werkzeuge daraus benutzen oder nur einzelne. Gewisse Fehlerkategorien kann sicher auch eine KI abprüfen, zum Beispiel das Überprüfen von Stilvorgaben, Terminologie, Grammatik, Rechtschreibung. Das Thema KI oder auch KI-Evaluierung wird in der aktuellen Fassung noch nicht behandelt, aber das liegt daran, dass die Norm erarbeitet wurde, bevor ChatGPT rauskam und der ganze KI-Hype losging. Der Final Draft International Standard ist im Herbst 2023 in die Abstimmung gegangen.
Eine KI kann gewisse Anforderungen sicherlich abprüfen. Das ist Tatsache – egal, wie man es dreht oder wendet. Was sie nicht kann – und da ist der Mensch einfach unschlagbar – das ist das Thema Semantik, also Bedeutung, Fehlübersetzung, Auslassungen, Hinzufügungen. Und um bewerten zu können, ob etwas sachlich falsch ist, muss man sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Wir stellen Windenergieanlagen her und die oberste Anforderung, die wir an unsere Übersetzer stellen, intern wie auch extern, ist: Sei im Detail vertraut mit unseren Produkten, dann verstehst du, was da steht und was gemeint ist und dann werden auch keine Fehler gemacht. Produktkenntnis ist der absolute Schlüssel. Darauf lege ich wirklich viel Wert: sowohl bei meinen internen Mitarbeitern, bei unseren externen Partnern und auch bei mir selbst ganz persönlich. Ich will, dass alle, die für ENERCON in meinem Wirkungsbereich arbeiten, sich auch wirklich für unsere Anlagen und unsere Technik interessieren. Wenn nicht, ist das ein Problem.
Das Thema Fehlübersetzungen wird auch in der Industrie viel zu wenig beachtet, weil es sich eben nicht fehlerfrei über KI abbilden und als Tools verkaufen lässt. Die Szene ist im Moment so unglaublich KI-zentriert und auf dem Auge Mistranslations völlig blind, finde ich. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung: Semantik und Bedeutung lassen sich nicht zuverlässig in einem Vektorraum darstellen. Wirklich „verstehen” kann eine Sache nur der Mensch. Die Maschine bzw. AI errechnet nur Wahrscheinlichkeiten. Man kann auch sagen, dass AI recht zuverlässig Bedeutung würfelt. Mit guten Ergebnissen. Aber sie würfelt – sie versteht nicht. Man darf sich bei der ganzen Diskussion um AI-Tools und AI-Prozesse nicht täuschen lassen, da stehen klare betriebswirtschaftliche Interessen von Tool- oder Prozess-Anbietern dahinter. Aber das wäre noch einmal ein ganz anderes Gespräch.
EMT: Das ist wohl wahr, auch das Thema Evaluierung ist von diesem Hype betroffen und es gibt dazu viele neue Produkte und Tools.
CHK: Gut, dass du das erwähnst, das gibt mir die Gelegenheit, auf das Thema Quality Estimation einzugehen. Quality Estimation hat nichts mit einer objektiven Bewertung von Übersetzungsqualität zu tun. Eine Quality Estimation sagt lediglich aus, welche MT-Matches zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Post-Editing erfordern und welche nicht. Hierzu haben wir erste Rückmeldungen erhalten, dass eine automatisierte Quality Estimation die Randbereiche gut erfasst, d. h. völlig falsch oder völlig richtig, aber der gesamte mehrdeutige Graubereich nicht oder nur unzuverlässig erfasst wird.
EMT: Du hast recht, das ist eines dieser neuen Themen, die man beobachten muss. ISO 5060 ist ja noch relativ neu. Was denkst du, wohin der Weg noch führt, unabhängig von der KI-Frage?
CHK: Normen werden alle fünf Jahre überprüft und überarbeitet, wenn die internationale Community den Bedarf dafür sieht. Der nächste sogenannte „Systematic Review“ findet 2029 statt. Da könnte dann z. B. das KI-Thema in die Norm kommen.
Ich sehe jedenfalls langfristig ein großes Existenzrecht für diese Norm. Denn leider machen sich die meisten Auftraggeber nicht die Mühe, ihre Übersetzungen auch mal inhaltlich zu prüfen. Da wird dann die Terminologie gerade gezogen, und es werden Grammatik- und Rechtschreibfehler korrigiert, aber der Blick für die Details und der Blick für den Inhalt, fehlt leider häufig. Und genau dies können AI-Tools einfach nicht abprüfen. Ich würde mir wünschen, dass die ISO 5060 in mehr Unternehmen etabliert wird, aber auch in Universitäten. Studenten wie Dozenten müssen lernen, dass Übersetzungsbewertung nicht willkürlich sein darf, sondern sich streng an den Anforderungen der Übersetzung orientieren muss.
Dafür bietet die Norm wirklich viel Handreichung, z. B. in Form von Fragen zur Implementierung oder auch drei sofort einsetzbare Scorecards. Übrigens: Erste CAT-Tool-Hersteller integrieren die Scorecards aus der ISO 5060 schon in ihre Evaluierungs-Features, was mich natürlich freut. So wird die Norm noch bekannter.
EMT: Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Normen einen echten Praxisbezug haben.
CHK: Ich stehe auch voll dahinter und sehe den Nutzen in meiner tagtäglichen Arbeit bei ENERCON. Übersetzungsqualität bringt Sicherheit! Darüber hinaus bekommen wir auch sehr viel positive Resonanz von unterschiedlichen Stakeholdern, z. B. von Universitäten, der EU und verschiedenen Verbänden.
EMT: Das wundert mich nicht, die Norm ist wirklich gut geworden! Christopher, schön, dass du dir für unsere Quality Time die Zeit genommen hast. Vielen Dank für den spannenden Austausch!
8 gute Gründe für oneword.
Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzen und was uns von klassischen Übersetzungsagenturen unterscheidet.
Wir liefern Ihnen 8 gute Gründe und noch viele weitere Argumente, warum eine Zusammenarbeit mit uns erfolgreich ist.