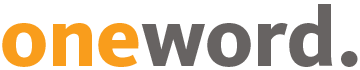13.02.2025
Quality Time mit Tom Winter: Gespräch mit dem DTT-Vorsitzenden über Terminologie, KI und Qualität
Es ist wieder Quality Time. Willkommen zu einer neuen Episode unserer Reihe von Expertengesprächen über Sprachdienstleistungen. Diesmal hat sich unsere Fachleitung Terminologiemanagement Jasmin Nesbigall mit Tom Winter, dem 1. Vorsitzenden des Deutschen Terminologie-Tag e. V. (DTT) unterhalten. Ein interessantes Gespräch über den Stellenwert von Terminologie in Unternehmen und die Rolle des DTT.
Tom Winter arbeitet als Terminologe, Computerlinguist und Data Scientist im Sprachenmanagement der Deutsche Bahn AG. Sein Schwerpunkt liegt unter anderem auf Prozessautomatisierung und der Integration, Beeinflussung und qualitativen Bewertung von MT-Systemen. Er ist Vorsitzender des Deutschen Terminologie-Tag e. V. und Mitglied im Rat für Deutschsprachige Terminologie (RaDT).
oneword ist seit 2014 Mitglied im Deutschen Terminologie-Tag e. V. und regelmäßige Teilnehmerin am alle zwei Jahre stattfindenden Symposion des Vereins. Unsere Fachleitung Jasmin Nesbigall trägt dieses Jahr erneut mit einem Vortrag zum Konferenzprogramm bei und freut sich auf 2,5 Tage Austausch, Input und Vernetzung.
Jasmin Nesbigall (JN): Hallo Tom! Wie schön, dass wir uns heute zum Thema Terminologie austauschen können. Das Thema fehlte uns bisher in der Quality Time und ich freue mich, dich als Vorsitzenden des Deutschen Terminologie-Tag e. V. heute hier als Gesprächspartner zu begrüßen.
Tom Winter (TW): Danke für die Einladung! Ich freue mich sehr, dass Ihr mich für dieses Thema auserkoren habt.
JN: Du bist Terminologe bei der Deutsche Bahn AG und 1. Vorsitzender des DTT. Wie bist du denn überhaupt zur Terminologie gekommen?
TW: Ich habe Übersetzen studiert, aber schnell gemerkt, dass es schwierig sein könnte, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil ich mich an einzelnen Formulierungen unendlich aufgehalten habe. Deswegen war ich froh, dass die TH Köln den Master für Terminologie und Sprachtechnologie bei Klaus-Dirk Schmitz angeboten hat, den ich an mein erstes Studium angeschlossen habe. Dieser Weg war ein guter, denn die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass Terminologie ein Themenbereich von steigendem Interesse und großer Wirkmacht ist, in dem man sich austoben kann.
Mich hat schon immer fasziniert, wie in unterschiedlichen Sprachen formuliert wird und was das über das Denken aussagt. Warum fragt man im Deutschen nach „dem Sinn des Lebens“, im Englischen aber nach „a meaning of life“? Im Deutschen setzen wir voraus, dass es einen Sinn – und zwar nur einen! – gibt, im Englischen bleibt es offen.
Viele sprachliche Ungenauigkeiten oder auch Fehler lassen sich aber beheben, wenn man auf die Definition eines Begriffs schaut. Denn man muss unterscheiden, was ein Merkmal und was eine Eigenschaft ist.
Nehmen wir das Beispiel Rassismus: Die Hautfarbe wird zum Merkmal gemacht, es wird zwischen schwarzen und weißen Menschen unterschieden. Hautfarbe ist aber eine Eigenschaft von Menschen, kein Merkmal. Es gibt nur eine Definition von „Mensch“. So lassen sich Konflikte auflösen auf Basis terminologischer Grundarbeit, also der logischen Datenstrukturierung. Terminologie kann den ganzen Rahmen – inhaltlich, politisch, gesellschaftlich – abdecken, indem man definiert und dabei immer wieder abgleicht: Was bedeutet das für dich und was bedeutet es für mich? Verstehen wir unter einem Begriff das Gleiche? Das führt zu Transparenz und Ansatzpunkten, um aufeinander zuzugehen und zu reden.
JN: Apropos zusammen: Wir befinden uns in einem Symposion-Jahr, denn vom 27. bis 29. März wird das zweijährliche Zusammentreffen des DTT in Worms stattfinden. Wie bist du zum DTT und zu deinem Posten als 1. Vorsitzender gekommen?
TW: Traditionell und auch logisch muss die Spitze des DTT aus dem Industriebereich besetzt werden, denn es darf niemand sein, der die Lehre beeinflusst oder ein eigenes Unternehmen verantwortet. Als der damalige 1. Vorsitzende Mark Childress zurücktrat, wurde ich für diese Position angefragt.
JN: Wie gut passen denn aus deiner Sicht die verschiedenen Gruppen im DTT zusammen? Es kommen dort Industrieunternehmen, Dienstleister und Freiberufler:innen, Tool-Hersteller und Vertreter:innen der Hochschulen zusammen. Jede Gruppe hat ja unterschiedliche Ansprüche. Bereichert sich diese Vielfalt gegenseitig oder steht dabei jede Interessensgruppe doch eher für sich?
TW: Das ist definitiv eine Herausforderung, an der wir arbeiten. Die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der Bereiche lassen sich an vielen Stellen leider nicht immer gut verbinden. Freelancer:innen wünschen sich beispielsweise Vernetzung und sind auf der Suche nach neuen Aufträgen. Letzteres ist aber nicht das Ziel von DTT-Veranstaltungen. Für Industriemitglieder haben wir 2019 das Industrieforum gegründet. Dort kommen über 30 Unternehmen zusammen, die sich vertrauensvoll austauschen über ihre Prozesse und Entwicklungen im Bereich Terminologie. Dabei liegt der Fokus klar auf dem Erfahrungsaustausch und nicht darauf, mit wessen Hilfe oder mit welchen Tools etwas dann schlussendlich umgesetzt wird. Wir versuchen als DTT, die Interessen aller Gruppen zu bedienen. Die Gesamtvernetzung ist eine echte Herausforderung, aber dafür dient ja alle zwei Jahre das Symposion, wo alle zusammenkommen.
JN: Auch beim Symposion ist ja aber nicht jeder Vortrag für jede:n Teilnehmer:in relevant. Achtet Ihr bei der Programmzusammenstellung auf eine ausgewogene Mischung aus allen Bereichen?
TW: Jedes Symposion hat ein aktuelles Grundthema. Die Initiator:innen des DIT (Deutsches Institut für Terminologie) sprechen gezielt Referent:innen an, die etwas zu diesem Thema beitragen können. Bei der Auswahl achten wir darauf, dass für jede Gruppe etwas dabei ist. Absolut im Vordergrund steht dabei die unabhängige Fachlichkeit. Wir haben in den letzten Jahren auch zusätzliche Elemente eingebaut, die die Veranstaltung auflockern sollen, zum Beispiel die musikalische Begleitung durch Dad’s Phonkey oder das terminologische Speed-Dating.
JN: Wann fühlt sich ein Symposion denn aus deiner Sicht erfolgreich an?
TW: Wenn wir es geschafft haben, trotz einjähriger Vorlaufzeit als aktuell und wegweisend wahrgenommen zu werden. Dabei sind drei Aspekte für das Symposion wichtig: Fachlichkeit, Unabhängigkeit und Vernetzung. Wenn das Symposion für seine Fachlichkeit wahrgenommen und geschätzt wird und wenn die Teilnehmer:innen zufrieden, mit neuem Input und gut vernetzt nach Hause gehen und wenn auch die Beiträge, die jemanden nicht so interessiert haben, wohlwollend angenommen wurden, dann war es eine erfolgreiche Veranstaltung. Zusätzlich zu diesen ideellen Zielen müssen wir aber natürlich auch unsere Kosten decken. In den letzten Jahren war ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Veranstaltung und die Teilnehmerzahlen sprechen für sich.
JN: Während man aber früher vielleicht mit zwei bis drei guten Inputs aus einem Tagungstag zufrieden war, versucht man heute den größtmöglichen Nutzen aus Veranstaltungen zu ziehen. Das liegt sicherlich auch am großen Konkurrenzangebot, zum Beispiel Webinare, in denen ich mich vom Schreibtisch aus weiterbilden kann. Hast du das Gefühl, dass sich die Erwartungshaltung an den persönlichen Benefit einer Veranstaltung wie dem Symposion geändert hat?
TW: Ja. In vielen Unternehmen ist eine Teilnahme sogar mit der Auflage verbunden, dass danach Bericht erstattet wird und eine Einschätzung erfolgen muss, wie viel man aus den Vorträgen lernen konnte. Der Benefit wird also ganz anders hinterfragt und gefordert. Vielleicht blockiert diese druckvolle Erwartungshaltung auch das Wirkenlassen und Sicheinlassen auf eine solche Veranstaltung. Denn man sollte so eine Veranstaltung doch als Gesamtkomposition sehen. Das Element der Vernetzung, zum Beispiel beim gemeinsamen Abendessen, sollte genauso zählen wie der fachliche Input. Wenn Unternehmen nur Fachlichkeit fordern, kann das alleine kaum wirken.
JN: Das Thema wird ja nochmal akuter durch Parallelveranstaltungen zu Terminologiethemen. Denn dann wird sicherlich auch abgewogen, wo das Programm interessanter ist und wo man mehr für sich mitnehmen könnte.
TW: Absolut. Parallelveranstaltungen sind an sich ja toll und bereichernd und aus fachlicher Sicht eine Freude. Aber der Markt hat halt nicht plötzlich doppelt so viel Geld. Was das Abwägen nach dem größtmöglichen Benefit langfristig für die Teilnehmerzahlen bedeutet, müssen wir einfach im Blick behalten.
JN: Es zeigt ja aber auch, dass das Interesse an Terminologie wächst. Lange Zeit führte das Thema in Unternehmen eher ein Schattendasein. Dieser Stellenwert hat sich in den letzten Jahren aber deutlich geändert. Was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür?
TW: Ganz klar die technische Entwicklung, angefangen durch Digitalisierung bis jetzt zum KI-Einsatz. Natural Language Processing (NLP) kam schon mit der Digitalisierung auf und hat jetzt durch KI nochmal einen Boost bekommen. Es wird viel mehr Text in Ketten automatisch generiert und verarbeitet. Terminologie kommt dabei ins Spiel durch die zunehmende Erkenntnis, dass diese Textkette und Textverarbeitung gestützt werden müssen. Terminologiearbeit ist in dieser Wertschöpfungskette ein stützender Prozess.
Erschwert wird das Ganze aber durch die Wahrnehmung, dass Sprache eben ganz normal und selbstverständlich ist. Die wenigsten Unternehmen kalkulieren die Kosten für Mehrsprachigkeit realistisch ein und daran scheitert dann auch die Terminologie.
JN: Ja, für viele ist es immer noch ein nice-to-have. Wir kennen die gesamte Bandbreite an Terminologiethemen in Unternehmen: Manche haben noch gar nicht damit angefangen, manche bauen nebenbei etwas auf. Andere arbeiten mit guten, gepflegten Beständen und bei einigen schlummern 15.000 Einträge seit 20 Jahren in einer fast vergessenen Datenbank. Wo drückt aus deiner Erfahrung denn der Schuh in Industrieunternehmen am meisten beim Thema Terminologie?
TW: Eigentlich ist es von allem ein bisschen. Wenn man Terminologiearbeit vernünftig umsetzen will, muss es ein unternehmensweiter Prozess sein. Dafür gilt es, den Wert und die Notwendigkeit zu vermitteln und das Ganze als Unterstützungsfunktion darzustellen. Ähnlich wie die HR-Abteilung oder das Controlling, deren Bestehen ja auch als selbstverständlich gilt. Wenn mir die HR-Abteilung allerdings Einstellungsgespräche abnimmt, freue ich mich über die direkt spürbare Unterstützung. Bei Terminologie ist das anders: Sie erfordert Zuarbeit der Fachabteilungen, die den Nutzen teilweise nicht direkt sehen können. Der Nutzen ist vielmehr gesamtunternehmerisch und für Terminolog:innen schwieriger zu vermitteln.
Weil die Terminologiearbeit übergreifend funktioniert, muss sie zentral aufgebaut sein, mit zentralem Budget, dem Wohlwollen der Kolleg:innen und der Förderung „von oben“. Die Geschäftsführung muss den Nutzen und Sinn erkennen und braucht dafür fundierte Kenntnis von Sprache, Technologien und vor allem vom Wissensmanagement. Und da hakt es bei vielen: zu oft werden nur die Kosten gesehen, an denen es dann scheitert.
Ähnlich verhält sich das direkt bei der Budgetverteilung: Hier haben neue Themen wie KI die Nase vorn. Für andere Bereiche wird dann das Budget gestrichen. Aber KI ohne Terminologie ist nicht denkbar. Natürlich gibt kein Bereich freiwillig sein Budget ab. Das passiert erst, wenn man an einen Punkt kommt, wo es ohne Terminologie nicht weitergeht.
KI wird gerade überall ausgerollt und es gibt immer mal wieder eine Nutzensteigerung, ohne dass man dafür etwas machen muss, allein, weil die Systeme immer ein bisschen besser werden. Deshalb kann man es lange herauszögern, selbst etwas zu verbessern. Für die letzten Meter müssen aber Unternehmensdaten, also Terminologie, integriert werden, um den vollen Nutzen rauszuholen.
JN: Es ist nicht nur so, dass Terminologie für die KI gebraucht wird, sondern auch, dass KI bei Terminologieaufgaben unterstützen kann. Wie sind deine Erfahrungen damit? Bei welchen Prozessen im Terminologielebenszyklus lässt sich KI jetzt schon sinnvoll einsetzen?
TW: Bei der Definitionserstellung sehe ich den Einsatz noch kritisch. Woher soll ein generisches System Fachdefinitionen nehmen? Es kann eventuell Vorarbeit leisten, die dann von Expert:innen geprüft werden muss. Hier sehe ich aber leider keinen großen Nutzen, sondern eher die Gefahr von Fehlinformationen.
Anders sieht es bei Metadaten aus. Nehmen wir das Beispiel Einfache Sprache. Einfache Sprache verlangt Konsistenz und transparente Benennungen. Im Bahnbereich ist zum Beispiel die Benennung „Andreaskreuz“ nichtssagend. Ich könnte dieses Schild „Zugwarnkreuz“ nennen, was deutlich aussagekräftiger ist: es ist ein Kreuz und es warnt vor herannahenden Zügen. Nach diesem Schema könnte man jetzt eine Terminologiedatenbank nehmen und mithilfe von KI alle vorhandenen Definitionen in Einfacher Sprache umformulieren lassen. Dann könnte man das System auffordern, für jeden Begriff eine beschreibende Benennung vorzuschlagen, die auch in Einfacher Sprache verständlich ist.
Wenn ich dann eine dieser Benennungen aus juristischen Gründen nicht verwenden darf, unterstützt mich die terminologische Konsistenz bei der Korrektur. Denn dann könnte ich zum Beispiel mein einheitlich verwendetes „Zugwarnkreuz“ in den Dokumenten wieder durch „Andreaskreuz“ ersetzen.
JN: Wie sieht es mit der Unterstützung von MT-Prozessen aus, also zum Beispiel die Glossarerstellung?
TW: Wenn Terminologie in MT-Systeme integriert wird, funktioniert das manchmal hervorragend und manchmal überhaupt nicht. Wenn man in einem Glossar zum Beispiel train = Bimmelbahn vorgibt, dann wird das bei der Übersetzung von „The train is delayed“ korrekt umgesetzt. Gibt man dann aber „The training was hard to follow” ein, erhält man „Die Bimmelbahn ist schwer zu verfolgen.“ Das Problem ist hier der gleiche Wortstamm, denn das Integrationsverfahren für Glossarvorgaben basiert oft auf Stemming.
Wenn man aber weiß, dass Benennungen mit identischem Wortstamm zu Fehlübersetzungen führen können, dann kann man sich wunderbar von KI unterstützen lassen. Dazu legt man ein Attributfeld „Wortstamm“ in der Datenbank an und lässt es die KI für alle Termini ausfüllen. Ich schätze, dass man zu mindestens 90 % korrekte Ergebnisse erhält. Mit diesem Attribut kann man weiterarbeiten und zum Beispiel Termini mit identischem Wortstamm aus dem Glossar ausschließen oder gesondert prüfen. Ein solcher Prozess wäre – zumindest bei großen Datenbanken – ohne KI nicht denkbar. KI kann viel bewirken, wenn man weiß, wie man sie integriert.
JN: Mit Definitionen haben wir interessante Tests gemacht. Wir haben einen Begriff von einer Terminologin und mithilfe von vier verschiedenen Prompts definieren lassen. Mit Blick auf alle Ergebnisse zusammen enthielt keine der fünf Definitionen alle Merkmale, die vorkamen. Das beste Ergebnis wäre also die Essenz aus allen Definitionen.
TW: Interessant! Ich denke, man muss sich auch ein bisschen vom Prinzip der Perfektion verabschieden und auch mal mit 80 % zufrieden sein. 100 % gibt es in vielen Bereichen einfach nicht. Auch über von Menschen erstellte Definitionen kann man sich ja streiten, weil es immer unterschiedliche Blickwinkel gibt. Kann es dann überhaupt eine Referenzdefinition als Goldstandard geben? Fünf Menschen würden auch unterschiedlich definieren.
Ich finde es zunehmend anstrengend, mit den beiden Antipoden umzugehen: Manche sind mit allem zufrieden, was aus der KI kommt und vergessen, kritisch zu hinterfragen, und die anderen lehnen es grundsätzlich ab und führen nur Negativbeispiele an.
JN: Das kennen wir ja von maschineller Übersetzung (MT) zur Genüge. Auch da gab es von Anfang an das Lager, dass MT ungefragt hinnimmt und sagt, man brauche keine menschlichen Übersetzer:innen mehr. Und das andere Lager greift jeden kleinsten Fehler der Maschinen auf und sagt „Solche Fehler hätte ein Mensch nie gemacht, MT taugt überhaupt nicht!“
TW: Stimmt. Aber irgendwie scheint man aus den 8 Jahren Vorsprung der maschinellen Übersetzung nichts gelernt zu haben.
JN: Ich finde, die Branche ist gelassener geworden. Beim Durchbruch von neuronaler maschineller Übersetzung gab es mehr Aufruhr, weil es alle schnell testen und nutzen wollten. Bei LLMs war die Reaktion gefühlt etwas abgeklärter und die Haltung war eher „Ah, der nächste Hype. Es wird ja aber nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird.“
TW: Absolut. Aber bei MT wurde die Diskussion nur innerhalb der Branche geführt, bei KI ist sie aber allumfassend. Jetzt reden alle mit.
JN: Wir merken, dass auch bei unseren Kund:innen der Ruf nach einem KI-Einsatz lauter wird. Bei vielen Gesprächen kommt die Frage auf, ob ein Prozess auch durch KI unterstützt werden kann und sich damit die Kosten senken lassen. Wie nimmst du es wahr: Ist der KI-Einsatz in der Terminologiearbeit in den Unternehmen schon angekommen oder ist es noch als Testphase zu werten?
TW: Wenn ich jetzt mal auf meinen Arbeitgeber und auf unser Industrieforum blicke, ist das je nach Unternehmen sehr unterschiedlich. Im Extremfall besteht die Vorstellung, Prozesse können einfach durch KI ersetzt werden, so dass das Budget gänzlich eingespart werden kann. Das ist vor allem bei Übersetzungen der Fall und nimmt gerade stark zu. Ähnliche Anforderungen werden aber auch in Richtung Terminologie laut mit der Frage, ob das nicht alles auch ChatGPT machen könne. Mit diesem Phänomen muss man sich auseinandersetzen, denn GPT wird als allmächtiges Tool wahrgenommen und mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage wird das noch kritischer werden.
Auf der anderen Seite stehen die Terminolog:innen, die schon lange in ihren Prozessen arbeiten. Auch da gibt es zwei Seiten: Die einen nehmen wahr, dass mit KI-Unterstützung viel möglich wäre, aber fragen sich, was dann für sie noch übrigbleibt. Da ist also eine Angst vor dem Überflüssigwerden und dem Jobverlust und deshalb bleibt lieber alles so, wie es ist. Die anderen sind sehr offen und haben schon konkrete Ideen und Vorstellungen für die Zeit, die durch den KI-Einsatz für sie frei wird.
Die Frage ist: werden wir den Punkt, an dem in ein paar Jahren Terminologie für das Wissensmanagement seine volle Blüte entfalten kann noch erreichen, wenn bereits jetzt zu beobachten ist, dass Unternehmen ihr langfristiges Commitment für etablierte Prozesse zugunsten falscher Hoffnung in die KI aufgeben?
JN: Du hast gerade die Gegensätze angesprochen: Terminolog:innen, die sich gar nicht mit KI beschäftigen wollen und andere, die das Thema als Chance sehen. Was für Skills braucht man denn aktuell für die Terminologiearbeit?
TW: Skills meint ja auch das Mindset. Terminologie muss raus aus dem translatorischen Bereich bzw. Übersetzungen müssen generell als Informationsverarbeitung angesehen werden, also als Informationen und Daten. Sprache wird als kompliziert wahrgenommen, aber das Komplexe daran sind nur die Ausnahmen. Und in Digitalisierung und KI ist das Wichtigste, zwischen Regel und Ausnahme zu unterscheiden. Regeln kann man automatisieren, um Ausnahmen kümmert sich dann der Mensch.
Wenn ich von Daten und Informationen rede, bin ich nur einen Schritt von Programmiersprachen, Digitalisierung und KI entfernt. Darin sehe ich die Anforderungen der nächsten Jahre für den Terminologiebereich. Terminologie kann nur als Element des Wissensmanagements bestehen. Es ist ein Unterstützungsprozess, zum Beispiel für Konsistenz. Alles im Unternehmen fußt auf der Unternehmenssprache, die ja auch die interne Suche, das ERP-System, Chatbots und die maschinelle Übersetzung bedient. Alle textverarbeitenden Prozesse basieren auf der Unternehmenssprache, die entsprechend gepflegt und bereitgestellt werden muss.
Terminolog:innen müssen das gesamte Unternehmen im Blick haben. Sie müssen Kontakte suchen, die Arbeitsweise anderer Abteilungen kennen, wissen, wie und wo sie unterstützen können. Dazu muss man sich mit der Unternehmensarchitektur beschäftigen und schauen, wie der Terminologieprozess dort verankert werden kann. Dann hat Terminologie eine Zukunft.
Die erforderlichen Skills sind also, das Mindset zu ändern und sich anschließend mit der Technik zu beschäftigen. Man braucht Kenntnisse in Python, SPARQL, und XML, Verständnis für Schnittstellen-APIs und dafür, wie Systeme interagieren. Im besten Fall kann man selbst programmieren.
JN: Ändert sich dann vielleicht auch irgendwann der Jobtitel? „Terminologin und Terminologe“ klingt ja immer noch nach Wörterbuch und Lupe. Was du beschreibst, wäre vielleicht eher ein „Language Data Manager“ oder „Corporate Language Manager“. Das würde vielleicht auch nach außen die notwendige übergeordnete Rolle aufzeigen.
TW: Kara Warburton hat das Buch „The Corporate Terminologist“ veröffentlicht. Sie stellt dort die Methodik der Terminologie in den Vordergrund, aber beschränkt sie nicht auf Terminologie, sondern spricht von „Microcontent“. Man beherbergt also jedwede Information in einer Terminologiedatenbank, um sie in andere Systeme zu bringen, die danach dürsten. Aber „Content“ kann ja alles sein. Wenn mir jemand sagt, das ist ein „Fachbericht“, habe ich doch eine ganz andere Erwartung daran als an „Content“. Wie wollen wir es aber nennen? „Daten“ ist viel zu unspezifisch.
„Terminologie“ mag ja veraltet sein, aber es hat einen Wert und ein Standing. Meine Hoffnung ist, dass dieser Benennung wieder mehr Wert beigemessen wird. Und dass man größeres Vertrauen hat, wenn man es „Terminologiedatenbank“ nennt, als wenn man von „Microcontent-Datenbank“ spricht. Das Wort mag veraltet sein und ist vielleicht auch eher hinderlich, um Budget zu bekommen. Aber in fünf oder zehn Jahren ist es vielleicht wieder von Wert, weil es vertrauensbildend ist.
JN: Vielleicht etablieren sich ja auch synonyme Benennungen.
TW: (Lacht.) Hast du Ideen?
JN: Aus dem Stehgreif nicht, aber ich denke gerne darüber nach. Wir kommen zu den fünf letzten, ganz kurzen Fragen, die du bitte auch möglichst knapp beantworten sollst.
Der DTT in drei Wörtern?
TW: Ich bleibe bei den Buchstaben und sage: Daten, Typen, Technologie.
JN: Terminologiearbeit ist für mich…?
TW: Essenziell.
JN: Wenn du ein Feature in Terminologietools zaubern könntest, welches wäre das?
TW: Die Verknüpfung von Terminologie und Ontologie. Bei Ontologien kann man zusätzliche Eigenschaften abbilden. Zum Oberbegriff „Affe“ kann man zum Beispiel die Fellfarbe für verschiedene Affenarten hinterlegen. In Terminologiedatenbanken ist es nicht möglich, einzelne Attribute als Wert einer Benennung anzuhängen. Das wäre in vielen Fällen auch übertrieben, aber nur so könnte Terminologie allumfassend genutzt werden. Wenn man die Methodiken nicht bündelt, wird es immer zwei getrennte Systeme geben müssen. Da wird sich aber niemand dranwagen, weil einfach kein Markt dafür da ist.
JN: Wie erklärst du fachfremden Leuten, was Terminologiearbeit eigentlich ist?
TW: Terminologie ist eine Vermittlertätigkeit. Man kann auch sagen: Lebenshilfe.
JN: Du bist also Wortagent! Da haben wir doch die gesuchte synonyme Benennung für Terminolog:innen. Und weil es nicht mehr lange bis zum Symposion dauert, geht meine letzte Frage um den DTT: Wo siehst du den Verein in zehn Jahren?
TW: Viel mehr verankert im Bereich des Wissensmanagements. Aktuell hat er großen translatorischen Bezug, das sind ja seine Wurzeln. Aber die Ausprägung in Richtung Wissensmanagement muss stattfinden, diese Lücke müssen wir schließen. Ob man dann überhaupt noch von Terminologie redet? Wir werden uns sicherlich nicht in „Deutscher Wortagentenverband“ umbenennen.
JN: Das wäre auch nicht wünschenswert. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Tom!
8 gute Gründe für oneword.
Erfahren Sie mehr über unsere Kompetenzen und was uns von klassischen Übersetzungsagenturen unterscheidet.
Wir liefern Ihnen 8 gute Gründe und noch viele weitere Argumente, warum eine Zusammenarbeit mit uns erfolgreich ist.